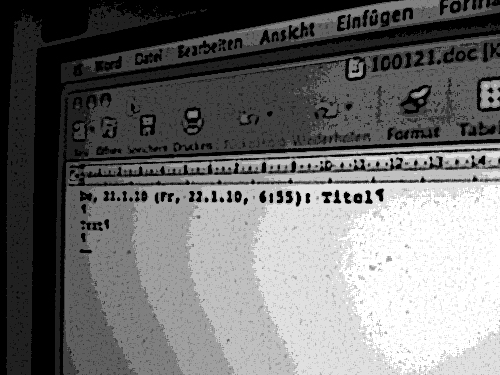Sa, 23.1.10 (So, 24.1.10, 7:10): Die Brüschen der Braut
(Skizze eines Traums, morgens gegen 10 Uhr:)
Die Brüschen der Braut
Die grün und blau geschlagene Braut mit Brüschen und Blessuren im Gesicht und am ganzen Körper. Spuren der Züchtigung durch ein Leben, das nicht glücklich verlief. Ich will sie heiraten.
Es gibt da so ein Komplettangebot, Trauung mit anschließender Feier, Buffet, Hotel, all inclusive. Die Paare heiraten am Fließband, im Akkord, im halbstündigen Abstand, in dem auch das Buffet wieder aufgefüllt wird - leidlich. Essen für alle das gleiche: gebratene Krabben auf riesigen Tabletts aus gepresster und dennoch zerbeulter Alufolie, ebenso Unmengen von Rührei und bleichem Baguette-Brot. Ich, der Bräutigam, strubbelig, Anzug zerrissen, fleckig und mit fehlenden Knöpfen, wie das Brautkleid aus dem Kostümverleih der All-inclusive-Heiratsfabrik.
Die eingeladene Verwandschaft ist einigermaßen erschüttert von diesem Aufgebot, versucht aber, sich das nicht anmerken zu lassen. Lediglich die Patentante kann ihr Entsetzen über die Brüschen der Braut nicht verhehlen. Irgendwann, im Gang zum Klo wirft sie es der Braut an den Kopf, die daraufhin die Patentante mit dem Kopf auf die Türkante schlägt. "Hier! Damit du weißt, wie es ist, wenn einen das Leben so schlägt!" Für die Pateneltern ist die Party damit natürlich vorbei. Sie verlassen meckernd das enge Gastzimmer.
Wir aber feiern gequält weiter, obwohl ich vor der Trauung eigentlich noch ein Interview mit einem bürgerlichen Politiker machen muss, in einem Nebensaal, wo eine Wahlveranstaltung stattfindet, die ich sprengen will, um dort für linke Ideale (oder was ich dafür halte) zweckfremd zu werben. Auf der Versammlung geht es um die Kosten der Integration von Fremden für die Gesellschaft. Sie seien zu hoch und zudem nutzlos ausgegeben, Integration sei gescheitert. Am Rednerpult, während ich Filme von "Gefangenen ihrer selbst" in sehr ärmlichen Verhältnissen (Berliner Mietskasernen aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende und der letzten, Marzahn) projiziere, argumentiere ich in die lärmende Menge, dass die Folgekosten einer nicht versuchten Integration, eine weitere Ghettoisierung von Gescheiterten und Gebeutelten viel höher seien, als jetzt in Integration nach neuen, linken Konzepten zu investieren. Ich werde ausgebuht. Nur der zu interviewende konservative Politiker findet meine Ansichten "putzig", allerdings hätten sie diesen "unangenehmen proletarischen Augout". Kleidete ich sie in bürgerlichere weiße Westen, könnte zumindest er sich mit meinen Ideen anfreunden. Das soll ich aber im Interview nicht schreiben.
Währenddessen hört man Jubelrufe aus dem Trauzimmer nebenan, wo das Paar vor uns gerade heiratet. Die Braut kenne ich aus Schulzeiten, sie erkennt mich aber nicht wieder. Sie heiratet einen Marineoffizier in Uniform und hat über den unteren Teil ihres Brautkleids eine grotesk große Anglerhose gezogen, Gummistiefel statt Pumps, auf dem Kopf auf dem Schleier eine karnevaleske Kapitänsmütze. Lächerlicher als dieser Aufzug ist die erkennbar plumpe Absicht, lächerlich zu wirken, die Zeremonie nicht ernst nehmen zu wollen. Der Bräutigam ist auffallend übergewichtig (und zauselig wie ich).
Diese Hochzeitsgesellschaft macht sich tuschelnd und verstohlen mit dem Finger zeigend über meine Braut und mich lustig. Sie moppsen, einen Teil des mit Klarsichtfolie abgedeckten Buffets, das für uns bereitgestellt wurde. Ich beschwere mich in der Küche. Die Küchenjungen und schmuddeligen Kaltmamsellen dort aber meinen, es tue ihnen leid, weg sei weg, sie könnten das nicht ersetzen, da der Komplettpreis sehr eng kalkuliert sei. Ich versuche dann noch, den Streit mit den Pateneltern zu schlichten, was wiederum meine Braut erzürnt. Sie verweist auf ihre Brüschen und bittet mich, die Pateneltern doch ziehen zu lassen. Sie verstehe mich, dass ich Harmonie stiften wolle, aber ich solle jetzt "endlich mal zu ihr stehen". Sie müsse aber auch nochmal kurz weg, die Parkuhr laufe ab, sie müsse nachwerfen, ich wisse ja, was Knöllchen kosten und dass wir sie uns nicht leisten können.
Auf dem Rückweg verspätet sie sich. Unsere Hochzeitsgesellschaft macht sich schon mal über die Buffet-Reste her, noch vor der Trauung. Ich halte eine Rede, warum ich SIE heirate, die mit den Brüschen. Gerade deretwegen stünde ich zu ihr, zumal manche der Blessuren ich ihr zufügte, wenn auch im übertragenen Sinne - "Kainsmale unserer Ehe". Überhaupt gehe es um Ideale, dass das Bewusstsein wieder das Sein bestimmen müsse, dialektisch natürlich. Die Argumente aus der Wahlversammlung passen auch hier. Vermutlich, so stelle ich gerade fest, habe ich beide Reden vertauscht. Na egal. Guten Appetit!
Außer mir ist kaum einer gerührt. Nur meine Schwester wirft mir ermutigende Blicke zu und gibt viel zu überschwänglichen Szenenapplaus. Sie trägt das Habit einer Krankenschwester, das sei jetzt modisch und passe ihr wie angegossen, augenzwinkert sie – und: "Nun mal Schluss mit Lyrik und ran an die Krabben (und die Brüschen)!". Dann taucht meine Braut wieder auf, mit noch mehr Brüschen und ein paar blutenden Kratzern. Da alle spachteln und der Standesbeamte drängt, heiraten wir ohne die Hochzeitsgesellschaft. Für Überraschungen waren wir ja schon immer gut, insofern ist das folgerichtig. Die Braut, jetzt meine Frau, bittet mich, sie vorsichtig zu küssen, ihre Brüschen täten so schon weh. Im Klogang von vorhin, wo die Patentante was abbekommen hatte, zieht sie eine abgewetzte Alltagsjeans über ihren nackten, striemigen Po. Ich soll mich bei dieser Umkleide vor sie stellen, weil überall noch Gäste von den Hochzeiten davor herumwandeln, zum Teil bereits sehr beschwippst und obszöne Bemerkungen machend. Und die Augen zumachen! Ihren Po mit den blauen Flecken zeige sie mir nur im Dunkeln, in der Hochzeitsnacht nachher, wenn wir zwischen den abgefressenen Krabbentabletts liegen, oder darauf, im Rühreirest.
Wir schlafen dann dort miteinander – oder doch nur ein, halb in der Küche, halb auf einer zu einem See hinter dem Hotel abschüssigen Wiese voller Kraut, Disteln, Pusteblumen und Gänseblümchen. "Rupfe keines", sagt sie, es komme eh immer "sie liebt mich, du liebst mich nicht" raus, was sich aber auf meine Familie beziehe, die entsetzte, immer noch gierig Krabben pulende aus den letzten Ecken der Küche. Ich möchte ihr den schmerzenden Po mit dem lauen Wasser aus dem Schilf lindernd kühlen. Sie lässt mich aber nicht gehen, eine Handvoll zu holen.
Es wird wieder hell, langsam. Und ein zarter "Nebeltauhauch", so nenne ich es, weht vom See zu uns herüber, wie eine Decke, die uns Schmerzensleute einhüllt. "Siehst", sagt sie, "im Liegen hab' ich Linderung." Bleib' also liegen! Es ist alles von selbst und dir geschenkt.
(ungefilterte Skizze, wie um ca. 10.30 Uhr antastbar)
Die Brüschen der Braut
Die grün und blau geschlagene Braut mit Brüschen und Blessuren im Gesicht und am ganzen Körper. Spuren der Züchtigung durch ein Leben, das nicht glücklich verlief. Ich will sie heiraten.
Es gibt da so ein Komplettangebot, Trauung mit anschließender Feier, Buffet, Hotel, all inclusive. Die Paare heiraten am Fließband, im Akkord, im halbstündigen Abstand, in dem auch das Buffet wieder aufgefüllt wird - leidlich. Essen für alle das gleiche: gebratene Krabben auf riesigen Tabletts aus gepresster und dennoch zerbeulter Alufolie, ebenso Unmengen von Rührei und bleichem Baguette-Brot. Ich, der Bräutigam, strubbelig, Anzug zerrissen, fleckig und mit fehlenden Knöpfen, wie das Brautkleid aus dem Kostümverleih der All-inclusive-Heiratsfabrik.
Die eingeladene Verwandschaft ist einigermaßen erschüttert von diesem Aufgebot, versucht aber, sich das nicht anmerken zu lassen. Lediglich die Patentante kann ihr Entsetzen über die Brüschen der Braut nicht verhehlen. Irgendwann, im Gang zum Klo wirft sie es der Braut an den Kopf, die daraufhin die Patentante mit dem Kopf auf die Türkante schlägt. "Hier! Damit du weißt, wie es ist, wenn einen das Leben so schlägt!" Für die Pateneltern ist die Party damit natürlich vorbei. Sie verlassen meckernd das enge Gastzimmer.
Wir aber feiern gequält weiter, obwohl ich vor der Trauung eigentlich noch ein Interview mit einem bürgerlichen Politiker machen muss, in einem Nebensaal, wo eine Wahlveranstaltung stattfindet, die ich sprengen will, um dort für linke Ideale (oder was ich dafür halte) zweckfremd zu werben. Auf der Versammlung geht es um die Kosten der Integration von Fremden für die Gesellschaft. Sie seien zu hoch und zudem nutzlos ausgegeben, Integration sei gescheitert. Am Rednerpult, während ich Filme von "Gefangenen ihrer selbst" in sehr ärmlichen Verhältnissen (Berliner Mietskasernen aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende und der letzten, Marzahn) projiziere, argumentiere ich in die lärmende Menge, dass die Folgekosten einer nicht versuchten Integration, eine weitere Ghettoisierung von Gescheiterten und Gebeutelten viel höher seien, als jetzt in Integration nach neuen, linken Konzepten zu investieren. Ich werde ausgebuht. Nur der zu interviewende konservative Politiker findet meine Ansichten "putzig", allerdings hätten sie diesen "unangenehmen proletarischen Augout". Kleidete ich sie in bürgerlichere weiße Westen, könnte zumindest er sich mit meinen Ideen anfreunden. Das soll ich aber im Interview nicht schreiben.
Währenddessen hört man Jubelrufe aus dem Trauzimmer nebenan, wo das Paar vor uns gerade heiratet. Die Braut kenne ich aus Schulzeiten, sie erkennt mich aber nicht wieder. Sie heiratet einen Marineoffizier in Uniform und hat über den unteren Teil ihres Brautkleids eine grotesk große Anglerhose gezogen, Gummistiefel statt Pumps, auf dem Kopf auf dem Schleier eine karnevaleske Kapitänsmütze. Lächerlicher als dieser Aufzug ist die erkennbar plumpe Absicht, lächerlich zu wirken, die Zeremonie nicht ernst nehmen zu wollen. Der Bräutigam ist auffallend übergewichtig (und zauselig wie ich).
Diese Hochzeitsgesellschaft macht sich tuschelnd und verstohlen mit dem Finger zeigend über meine Braut und mich lustig. Sie moppsen, einen Teil des mit Klarsichtfolie abgedeckten Buffets, das für uns bereitgestellt wurde. Ich beschwere mich in der Küche. Die Küchenjungen und schmuddeligen Kaltmamsellen dort aber meinen, es tue ihnen leid, weg sei weg, sie könnten das nicht ersetzen, da der Komplettpreis sehr eng kalkuliert sei. Ich versuche dann noch, den Streit mit den Pateneltern zu schlichten, was wiederum meine Braut erzürnt. Sie verweist auf ihre Brüschen und bittet mich, die Pateneltern doch ziehen zu lassen. Sie verstehe mich, dass ich Harmonie stiften wolle, aber ich solle jetzt "endlich mal zu ihr stehen". Sie müsse aber auch nochmal kurz weg, die Parkuhr laufe ab, sie müsse nachwerfen, ich wisse ja, was Knöllchen kosten und dass wir sie uns nicht leisten können.
Auf dem Rückweg verspätet sie sich. Unsere Hochzeitsgesellschaft macht sich schon mal über die Buffet-Reste her, noch vor der Trauung. Ich halte eine Rede, warum ich SIE heirate, die mit den Brüschen. Gerade deretwegen stünde ich zu ihr, zumal manche der Blessuren ich ihr zufügte, wenn auch im übertragenen Sinne - "Kainsmale unserer Ehe". Überhaupt gehe es um Ideale, dass das Bewusstsein wieder das Sein bestimmen müsse, dialektisch natürlich. Die Argumente aus der Wahlversammlung passen auch hier. Vermutlich, so stelle ich gerade fest, habe ich beide Reden vertauscht. Na egal. Guten Appetit!
Außer mir ist kaum einer gerührt. Nur meine Schwester wirft mir ermutigende Blicke zu und gibt viel zu überschwänglichen Szenenapplaus. Sie trägt das Habit einer Krankenschwester, das sei jetzt modisch und passe ihr wie angegossen, augenzwinkert sie – und: "Nun mal Schluss mit Lyrik und ran an die Krabben (und die Brüschen)!". Dann taucht meine Braut wieder auf, mit noch mehr Brüschen und ein paar blutenden Kratzern. Da alle spachteln und der Standesbeamte drängt, heiraten wir ohne die Hochzeitsgesellschaft. Für Überraschungen waren wir ja schon immer gut, insofern ist das folgerichtig. Die Braut, jetzt meine Frau, bittet mich, sie vorsichtig zu küssen, ihre Brüschen täten so schon weh. Im Klogang von vorhin, wo die Patentante was abbekommen hatte, zieht sie eine abgewetzte Alltagsjeans über ihren nackten, striemigen Po. Ich soll mich bei dieser Umkleide vor sie stellen, weil überall noch Gäste von den Hochzeiten davor herumwandeln, zum Teil bereits sehr beschwippst und obszöne Bemerkungen machend. Und die Augen zumachen! Ihren Po mit den blauen Flecken zeige sie mir nur im Dunkeln, in der Hochzeitsnacht nachher, wenn wir zwischen den abgefressenen Krabbentabletts liegen, oder darauf, im Rühreirest.
Wir schlafen dann dort miteinander – oder doch nur ein, halb in der Küche, halb auf einer zu einem See hinter dem Hotel abschüssigen Wiese voller Kraut, Disteln, Pusteblumen und Gänseblümchen. "Rupfe keines", sagt sie, es komme eh immer "sie liebt mich, du liebst mich nicht" raus, was sich aber auf meine Familie beziehe, die entsetzte, immer noch gierig Krabben pulende aus den letzten Ecken der Küche. Ich möchte ihr den schmerzenden Po mit dem lauen Wasser aus dem Schilf lindernd kühlen. Sie lässt mich aber nicht gehen, eine Handvoll zu holen.
Es wird wieder hell, langsam. Und ein zarter "Nebeltauhauch", so nenne ich es, weht vom See zu uns herüber, wie eine Decke, die uns Schmerzensleute einhüllt. "Siehst", sagt sie, "im Liegen hab' ich Linderung." Bleib' also liegen! Es ist alles von selbst und dir geschenkt.
(ungefilterte Skizze, wie um ca. 10.30 Uhr antastbar)
oegyr - 24. Jan, 08:21
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks